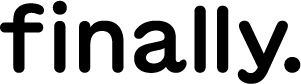Unterrepräsentiert: Chronische Krankheiten in der Schweiz
Share
Wenn wir heute ans Kranksein denken, stellen wir uns wahrscheinlich einen vorübergehenden Ausnahmezustand vor. Wir bleiben ein paar Tage Zuhause, gehen vielleicht einmal zur Ärzt:in oder, wenn es schlimm kommt, zur Notaufnahme. Für viele Menschen bleibt es jedoch nicht bei diesem einen Gang zur Notaufnahme: die Symptome bleiben oder verschlechtern sich sogar und weitere medizinische Abklärungen und Interventionen folgen. Es beginnt ein Prozess, eine Reise. Das Akute wird zur einer Konstante im Leben.
Laut der letzten Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2022 hatten 37% der Schweizer Bevölkerung mindestens eine nichtübertragbare bzw. chronische Erkrankung, kurz NCD (Noncommunicable Disease). Das entspricht 2,7 Millionen Menschen ab 15 Jahren in der Schweiz [1]. Diese Zahl setzt sich aus einer begrenzten Auswahl an Krankheiten aus den 5 wichtigsten Gruppen chronischer Erkrankungen in der Schweiz zusammen:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Erkrankungen des Bewegungsapparates (Muskeln, Knochen und Gelenke)
- Chronische Atemwegserkrankungen
- Krebs
- Diabetes
Chronische Krankheiten können eine Person bei Alltäglichen Aktivitäten teils massiv, teils weniger stark einschränken und insgesamt zu einer geringeren oder veränderten Lebensqualität führen. Dies zeigen auch die Angaben der Befragten der Schweizer Gesundheitsbefragung 2022. Besonders auffällig ist die Situation von Menschen mit einer Depression: verglichen mit den 5 anderen Gruppen die erhoben wurden, geben Menschen mit einer Depression überdurchschnittlich häufig an, bei alltäglichen Aktivitäten stark eingeschränkt zu sein, weniger soziale Unterstützung zu erfahren, und stufen ihre Lebensqualität häufiger als gering ein.
In den 2,7 Millionen sind bspw. Menschen mit Depressionen nicht enthalten. Depressionen betreffen laut der Gesundheitsbefragung 9.8% der Bevölkerung und verlaufen oft wiederkehrend und chronisch [2]. Ein wichtiger Grund für diesen Unterschied ist, dass Menschen mit Krankheit oder Behinderung, vor allem jene mit einer für andere nicht sichtbaren Krankheit oder Behinderung, oft stigmatisiert und nicht ernst genommen werden. Betroffene müssen sich immer wieder aufs Neue rechtfertigen, wieso sie nicht so «funktionieren» können, wie andere es von ihnen erwarten. Dies führt zu sozialer Ausgrenzung und einer grossen psychischen Belastung, die sich wiederum weiter negativ auf die Gesundheit auswirken [3]. Besonders bei NCDs ist die Anzahl Personen deren Krankheit für andere unsichtbar ist sehr hoch.
NCDs haben sehr unterschiedliche Ursachen; sie werden beeinflusst durch eine Kombination von genetischen, physiologischen, umweltbedingten und verhaltensbedingten Faktoren [4]. In vielen Fällen kann die genaue Ursache für eine Erkrankung gar nicht erst identifiziert werden. Was chronische Krankheiten jedoch gemeinsam haben, ist, dass sie uns herausfordern, unser Leben und unsere Identität neu zu gestalten – oft begleitet von Schmerz und Unsicherheit. Doch in diesem Wandel liegt auch die Chance, Prioritäten zu hinterfragen, neue Wege zu entdecken und unser Verhältnis zu uns selbst und unserem sozialen Umfeld bewusster zu formen.
Wie die Schriftstellerin Paula Fürstenberg in ihrem Beitrag für die Publikation zur Ausstellung «Hauptsache Gesund» [5] im Stapferhaus schreibt, braucht es, um die Gesundheit und das Wohlergehen von Menschen mit Krankheit und Behinderung zu fördern, weit mehr als bessere Forschung und Therapien: Es braucht einen tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft. Menschen mit Krankheit und Behinderung sind ein zentraler Teil unserer Gesellschaft.
Wenn wir weiterhin Krankheit hauptsächlich als einen vorübergehender Ausnahmezustand verstehen, werden wir der Lebensrealität, den Bedürfnissen und dem Recht auf Teilhabe von Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderung nicht gerecht.
Im nächsten Blog Eintrag werden wir darüber sprechen, wer in der Schweiz am meisten von chronischen Erkrankungen betroffen ist.
[1] OBSAN (2024, 21. November). Prävalenz NCD (Alter: 15+). https://ind.obsan.admin.ch/indicator/monam/praevalenz-ncd-alter-15. Abgerufen am 14. Januar 2025.
[2] OBSAN (2024, 6. August). Depressionssymptome. https://ind.obsan.admin.ch/indicator/obsan/depressionssymptome. Abgerufen am 14. Januar 2025.
[3] Schneider, Markus med. pract. (o. D.). Nicht sichtbare Behinderungen. https://www.enableme.ch/de/behinderungen/unsichtbare-behinderungen-9249. Abgerufen am 15. Januar 2025.
[4] ETH Zürich (o.D.). Chronische Erkrankungen. https://ethz.ch/studierende/de/beratung/besondere-studiensituationen/studium-und-behinderung/info-studieren-mit-behinderung/chronische-erkrankungen.html. Abgerufen am 14. Januar 2025.
[5] Hermann, N. et al. (Hrsg.). (2024). Hauptsache Gesund? (S. 60). Stapferhaus.