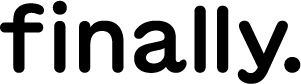Das Bett – Ort zwischen Intimität, Pflege und Macht
Das Bett ist weit mehr als ein Möbelstück für Schlaf und Erholung. Es ist ein vielschichtiger Raum, der – je nach Alltag, Lebenswelt und Kontext – unterschiedliche Bedeutungen im Lebensverlauf und im Feld der Gesundheit einnimmt.
Einerseits dient das Bett als Rückzugs-, Erholungs-, Wellness- und Schlafort. Es unterstützt physische, seelische und mentale Regeneration und trägt wesentlich zum allgemeinen Wohlbefinden und zur Leistungsfähigkeit bei. In modernen, digitalisierten Gesellschaften wird das Bett zunehmend auch zum Arbeits- und Schauplatz, an dem die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen.
Gleichzeitig hat das Bett soziale und kulturelle Facetten: Es ist Teil von Ritualen, steht für Intimität und Zuwendung – oder für das Gegenteil. Es kann Vertrauen evozieren, Nähe schaffen, aber auch Distanz, Macht oder Abhängigkeit symbolisieren.
Doch das fürsorgliche, materielle Ding kann sich auch in ein Symbol des Unbehagens verwandeln – etwa, wenn es an körperliche Übergriffe, Schlafstörungen, Krankheit, Schmerz, Angst, Scham oder Albträume gebunden ist. Dann wird das Bett zum Ort der Limitierung, Isolation und Einsamkeit – zu einem Raum emotionaler und körperlicher Belastung. Besonders dann, wenn es aufgrund einer schweren Erkrankung zum zentralen Aufenthaltsort und Lebensraum wird.
Hier wandelt sich nicht nur die freiwillige Nutzung in eine unfreiwillige, sondern auch Bedeutung und Funktion des Bettes verändern sich grundlegend. Es wird zum Zentrum der Macht: Ort medizinischer Überwachung, pflegerischer Kontrolle, körperlicher Disziplinierung – und zugleich Schauplatz existenzieller Gespräche über Leben und Tod.
Das Bett begleitet uns also nicht nur durch verschiedene Lebensphasen und Gesundheitszustände, sondern ist auch ein ökonomisches und politisches Diskursobjekt. Es prägt Prozesse der Disziplinierung und Normalisierung des Körpers, setzt normative Rahmen und korrigiert Abweichungen. Kaum ein anderes Objekt symbolisiert so deutlich die Übergänge zwischen Gesundheit und Krankheit, zwischen Leben und Tod.
In einer postmodernen Perspektive ist das Bett längst mehr als ein Schlafplatz – es ist ein hybrider Raum, in dem Intimität und Öffentlichkeit ineinanderfliessen. Es dient als Kulisse inszenierter Lebenswelten auf Social Media, als flexibler Arbeitsort oder als konsumierbares Ästhetikobjekt, das in Hochglanzmagazinen als Oase der Entspannung präsentiert wird. Gleichzeitig bleibt es ein Ort existenzieller Erfahrungen: der Geburt, der Liebe, der Krankheit – und des Sterbens.
Das Bett ist zentraler Angelpunkt meiner designanthropologischen Forschung, die sich mit der Niederlage des Lebens, dem Krank- und Altwerden und im Besonderen mit dem Sterben auseinandersetzt. Daher habe ich das komplexe Ding, in dem wir niederliegen, in verschiedene Betttypen zerlegt, um seine unterschiedlichen Facetten aus verschiedenen Perspektiven sichtbar zu machen:
-
Das Krankenhausbett verweist auf Planung, Effizienz und Kontrolle.
-
Das Pflegebett zeigt die Perspektive der Pflegenden und die Beziehung zu den Pflegebedürftigen.
-
Das Patient:innenbett legt den Fokus auf die Erfahrung derjenigen, die im Bett liegen müssen.
-
Das Angehörigenbett spiegelt die Nähe und Ohnmacht der Begleitenden.
-
Das Doppelbett lässt sich als Indikator für Krisen lesen – etwa durch seine Abwesenheit.
-
Das Sterbebett betrachtet die moderne Niederlage des Sterbens und verweist auf Zeiten, in denen Tod und Sterben noch als Teil des Lebens galten und durch Rituale eingebettet waren.
-
Die Totenbarre und schliesslich der Sarg bilden das letzte Kapitel dieser Forschung.
Mit dieser Einteilung folge ich nicht nur einer analytischen Logik, sondern versuche, der Ambivalenz und Vieldeutigkeit des Bettes auf die Spur zu kommen. Denn in seiner Widersprüchlichkeit spiegelt das Bett die Grundkonflikte menschlicher Existenz: Es ist Schutzraum und Gefängnis, Rückzugsort und Bühne, Ort der Erholung und der Disziplinierung zugleich.
Wie wir schlafen, wachen, heilen und sterben – all das spiegelt sich in den Formen des Bettes wider. Und letztlich auch in unserem Verhältnis zur Welt und zu uns selbst.
Text: Bitten Stetter