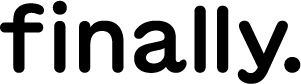Krankenhemd
Das Krankenhemd ist ein standardisiertes Textil für Patient:innen; es ist ein Kleidungsstück, das soziale, körperliche und emotionale Bedeutungen transportiert. Nicht als Spitalhemd oder Pflegehemd, sondern als Krankenhemd betrachtet, zeigt es, wie Kleidung in Gesundheitskontexten Funktionen übernimmt, die weit über Schutz oder Hygiene hinausgehen. In der Arbeit mit erkrankten Menschen wird deutlich, dass das Hemd Identifikation, Distanz, Kontrolle oder Verlust vermitteln kann. Es ist ein Spiegel der Krankheitserfahrung: Eine Patientin auf der Palliativstation sagt, sie habe das Hemd nach Operationen getragen, doch bei lebensbedrohlicher Krankheit verweigere sie das „Zelt“, das ihr Unwohlsein verstärkt. Das Hemd fungiert als „krankmachendes Kleid“ – es kann Selbstvertrauen und Autonomie mindern, während die Pflegenden dessen Tragen oft mit erhöhter Kooperationsbereitschaft verbinden.
Das Hemd wird zugleich zum Instrument der Disziplinierung. Es macht Verletzlichkeit sichtbar und markiert die Rolle des liegenden Körpers im institutionellen Raum. Frau F. beschreibt das Nachthemd als schutzlos: Der Körper wird entblößt, während er eigentlich geschützt sein möchte. Elias (1997) bezeichnete Kleidung als Zivilisationsgerät; im Gesundheitskontext wird das Nachthemd zum Disziplinierungsgerät, das Passivität und Liegen erzwingt, gleichzeitig aber auch Subversion erlaubt – als Rebellion gegen die Kontrolle und als Inszenierung von Krankheit und Sterblichkeit.
Nicht nur körperlich, auch sozial symbolisiert das Krankenhemd: Es legitimiert Liegende, schützt sie vor moralischer Bewertung von Faulheit und Nichtstun. Patient:innen tragen es, um sichtbar krank zu sein, ohne sozial exkludiert zu werden. Andere versuchen, den Status „sterbend“ zu vermeiden, indem sie Kontrolle über ihr Blutbild behalten oder alternative Kleidung wählen. Das Hemd wird zum Medium, über das gesellschaftliche Normen, moralische Erwartungen und individuelle Autonomie verhandelt werden.
Schließlich zeigt sich: Das Krankenhemd ist kein bloß funktionales Objekt. Es ist ein komplexes Geflecht aus Materialität, sozialer Interaktion und emotionaler Bedeutung, das in seiner Praxis entsteht und sich ständig neu kontextualisiert. Es vermittelt Macht, Schutz, Exponiertheit, Rebellion und Zugehörigkeit. Die Analyse dieses Textils verdeutlicht, dass selbst scheinbar triviale Objekte wie Kleidung im Pflegeprozess zentrale Rollen einnehmen als Ausdruck des Körpers, des Subjekts und der institutionellen Ordnung gleichermassen.